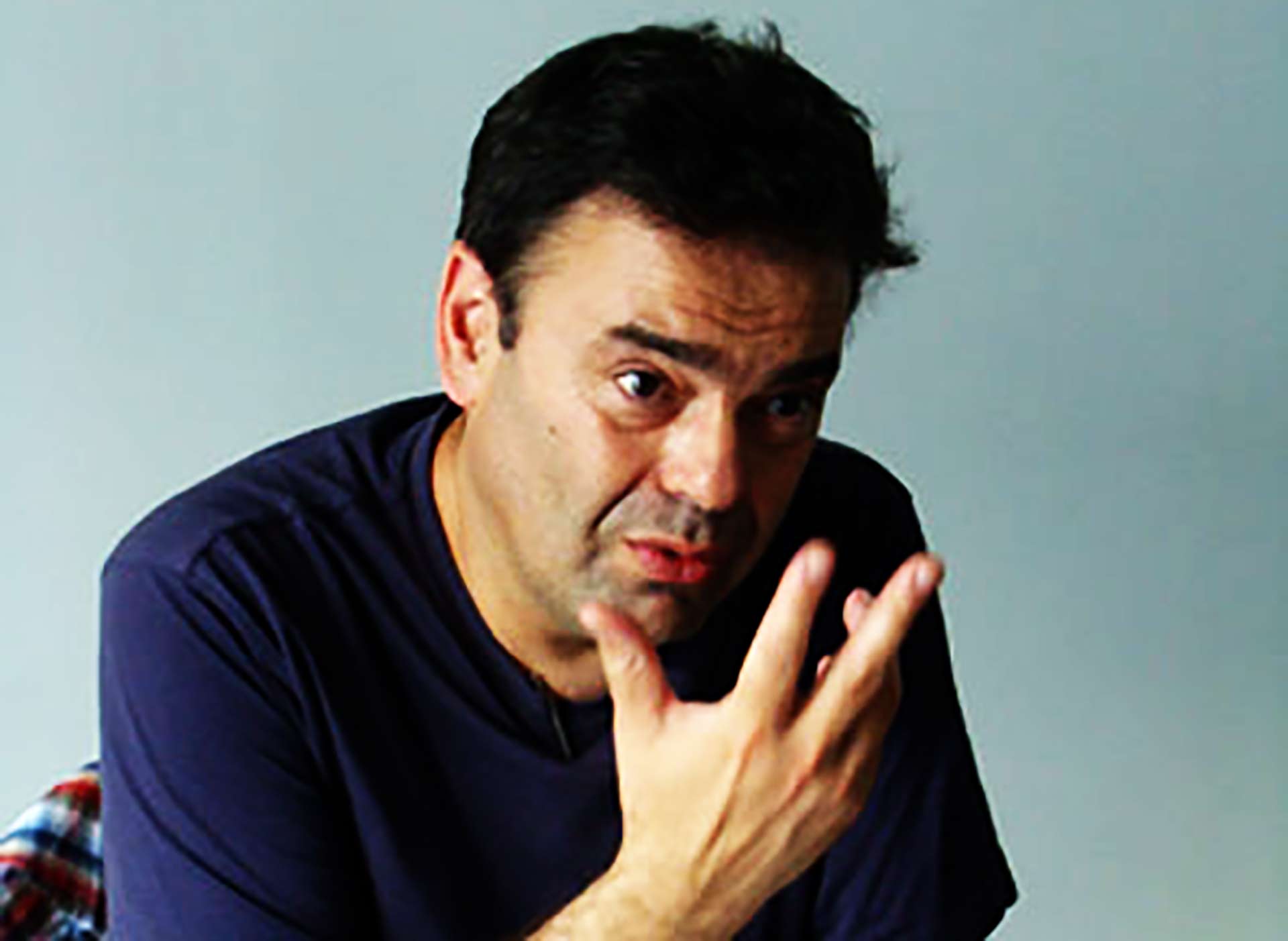
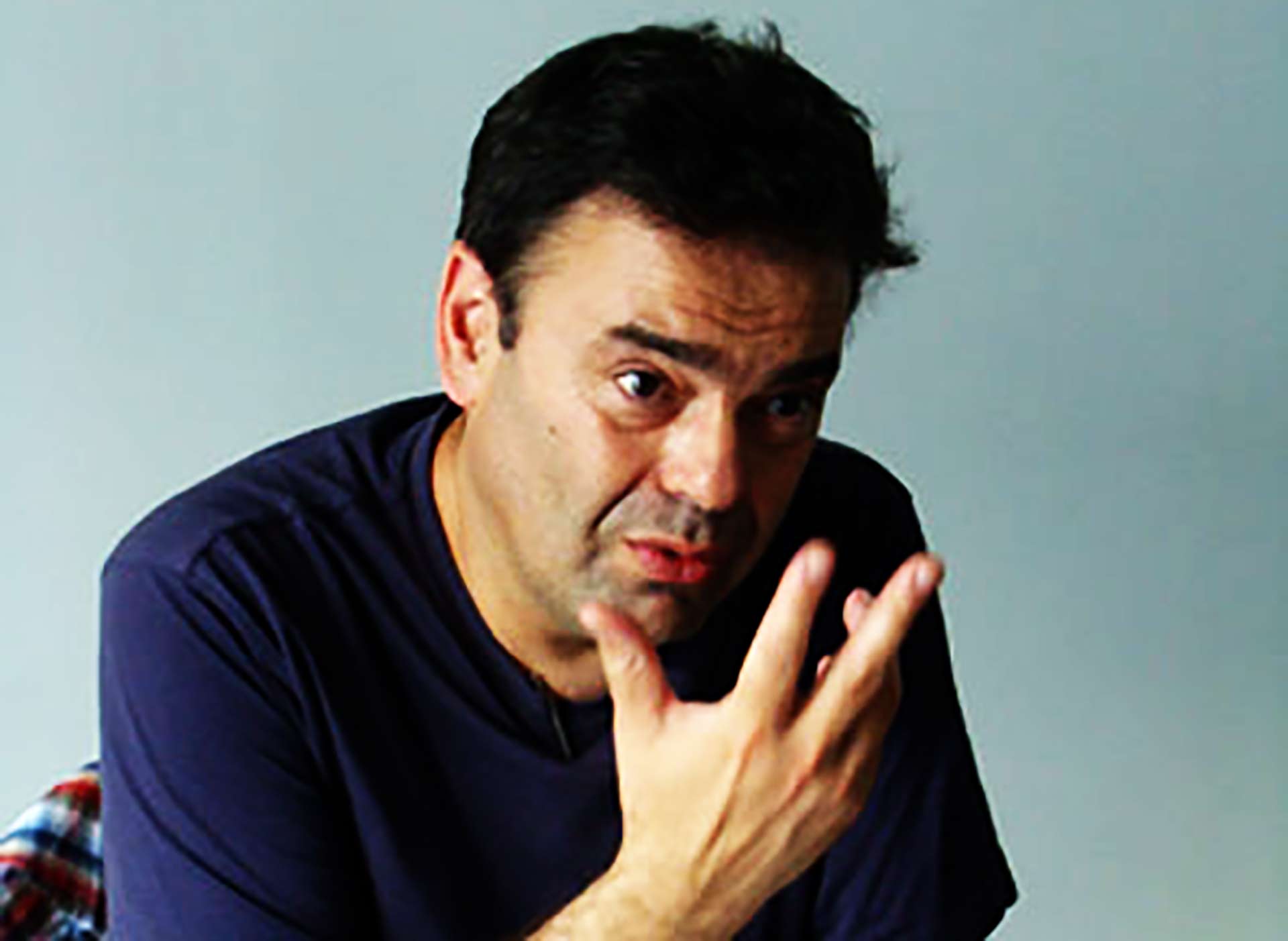
Von der Flucht in den deutschen Barock
Berlins kleistisch angehauchten Orten und den Herausforderungen der Kategorie F
Ein Interview mit László Márton
László Márton wählt seine Worte sehr genau. Die Poetik der Verzögerung ist für ihn Programm. Nicht nur in seinen Romanen verzögert er, sondern auch in diesem Interview holt er weit aus, um dann exakt dort wieder den Faden aufzunehmen, wo er ihn verlassen hat. Mit seiner besonderen Beziehung zur deutschen Sprache tritt Márton als Übersetzer immer wieder in Dialog mit den verstorbenen Autoren. In seiner schriftstellerischen Tätigkeit nutzt er den Bewegungsraum der Historie mit ihren zahlreichen Gestalten und Geschichten, um das Verhältnis von Individuum und staatlicher Macht zu erforschen. Bei der Rezeption der eigenen Werke sind Márton ungebildete Leser ohne Vorurteile wesentlich lieber als gebildete mit Vorurteilen.
László Márton ist Autor von mehreren Romanen, u.a. Jakob Wunschwitz igaz története 1997 (dt. Die wahre Geschichte des Jacob Wunschwitz 1999), Árnyas fõutca 1999 (dt. Die schattige Hauptstrasse 2003), Minerva búvóhelye 2006 (dt. Das Versteck der Minerva 2008) sowie des Bandes Sonderzeichen Europa 2010, einem Briefwechsel mit der japanischen Schriftstellerin Yoko Tawada. Außerdem übersetzt László Márton Werke aus dem Deutschen und Englischen. Die literarische Karriere des studierten Germanisten und Soziologen begann 1983, als er anfing, eigene Erzählungen zu veröffentlichten. Zu dieser Zeit arbeitete er bereits als Lektor beim Helikon-Verlag, wo er Übersetzer betreute, aber auch selbst vom Deutschen ins Ungarische übersetzte, u. a. die Werke Luthers, Goethes und Kleists. Nach der politischen Wendeverbrachte der 1959 in Budapest geborene Schriftsteller mit einem DAAD-Stipendium einige Zeit in Berlin – und lernte die Stadt lieben. Mehrere Male sollte er zurückkehren, zuletzt 2010, als er die Siegfried-Unseld-Professur an der Humboldt-Universität wahrnahm. Zurzeit lebt László Márton als freier Autor in Budapest.


novinki: Sie hatten in Ihrer Antrittsvorlesung vom Chronotopos Berlin gesprochen und davon, wie inspirierend diese Stadt sei und welchen Einfluss sie auf die ungarische Literatur und die Schriftsteller hatte. Was aber macht für Sie persönlich den Reiz, den genius loci, von Berlin aus?
László Márton: Das Verhältnis zu Berlin hängt eng mit meiner Lebensgeschichte zusammen. In meiner Jugend war ich mehrmals in Ostberlin, diese Besuche hatten keine große Bedeutung für mich. Ganz anders als mein erster längerer Aufenthalt in Berlin 1996, der mir zu meinem ersten Roman Die wahre Geschichte des Jacob Wunschwitz verholfen hat. Damals erlebte ich zum ersten Mal, wie befreiend und inspirierend die Stadt auf einen wirken kann. Ich habe einfach gemerkt, dass es Gedanken oder Ideen gibt, die mir anderswo nicht einfallen würden.
Nachdem ich nach Budapest zurückgekehrt war, konnte ich weiterarbeiten, weil diese fruchtbare Wirkung, die die Atmosphäre der Stadt auf mich ausübte, noch einige Monate oder sogar Jahre andauerte. Außerdem möchte ich, wo schon das Wort Chronotopos gefallen ist, sagen, dass auch die Topographie der Stadt eine fast schon hypnotische Wirkung auf mich ausübt, wobei ich betonen muss, dass eine Stadt nicht nur aus Straßen, Häusern, Straßenbahnen, Straßenbahnlinien, S- oder U‑Bahn besteht, sondern auch aus ihren Bewohnern, die ich kennenlernen und liebgewinnen, mit denen ich reden kann.
n.: Oft entdeckt man in der Fremde das Eigene wieder. Würden Sie sagen, dass Sie durch das kreative Potential Berlins besondere Freiheiten für sich gewinnen konnten? Hat dies etwas mit der Geschichte der Stadt zu tun: mit ihrer Zerstörung, ihrer ‘Neuerfindung’, ihrer Wandelbarkeit?
L.M.: Berlin ist eine Stadt, in der man auf Dauer nicht fremd bleiben kann. Entweder man versteht die Stadt einigermaßen – und ich würde sagen, ich habe etwas von Berlin verstanden – und man wird dadurch Berliner. Ich bin kein Deutscher, ich bin Ungar, aber trotzdem auch Berliner geworden. Das bedeutet auch, dass ich im Bus nicht im Obergeschoss sitze, keine Fotos mache und außerdem keinen Stadtplan brauche, wenn ich von Mitte nach Prenzlauer Berg fahren will. Aber vor allem bedeutet es, dass ich die Logik der Stadt ein wenig begriffen habe.
Oder aber man versteht die Stadt nicht. Berlin – anders als etwa München oder Frankfurt am Main – erträgt auch viel Fremdheit: Menschen, die die Sprache nicht sprechen, die die Geschichte nicht kennen, die nur vor sich hin leben, und sie gehören auch dazu. Sie sind auf gewisse Weise auch Berliner, selbst wenn sie davon nichts wissen.
n.: Sie hatten die Möglichkeit, sich einige Zeit in der DDR aufzuhalten. Empfanden Sie damals in der DDR einen Unterschied zu den ungarischen Verhältnissen?
L.M.: Ich habe die DDR mehrmals besucht, aber meistens als Privatperson. In meiner Kindheit habe ich zweimal jeweils einen Monat bei einer Familie in Leipzig verbracht. Dort habe ich auch die deutsche Sprache einigermaßen erlernt. Das hatte mit der DDR eigentlich nichts zu tun, sondern nur mit dieser Familie.
Eine bewusste Erfahrung war dagegen mein Teilstudium in Jena 1982/83. Ich hatte eine starke Abneigung gegen die DDR und wollte daran eigentlich nicht teilnehmen. Aber dann fuhr ich trotzdem nach Jena und das war eine angenehme Überraschung für mich, weil ich sofort verstanden habe, dass zum einen der einzelne Mensch nicht mit der DDR gleichzusetzen ist, und dass ich zum anderen unter den dortigen Umständen sehr gut arbeiten kann. Ich konnte die ehemals fürstliche Bibliothek in Weimar besuchen. Ich konnte Bücher lesen, die Goethe und Herder auch gelesen hatten. Ich habe sehr viel gelernt und mich sehr wohl gefühlt, und zwar nicht wegen, sondern trotz des politischen Systems. Außerdem – und das hängt mit meinem Habitus, meiner Bildung und meiner Natur zusammen – ließ ich mich politisch nicht provozieren. Ich sagte damals, dass ich mich mit dem 17. Jahrhundert und der Barock-Lyrik beschäftigen wolle und das war meine Antwort auf jegliche politische Fragen. Wenn ich also gefragt wurde, wie meine Meinung zum Marxismus-Leninismus sei, antwortete ich, dass im 17. Jahrhundert weder Marx noch Lenin gelebt hätten. Das war keine heldenhafte Antwort, aber sie funktionierte.
n.: In beiden sozialistischen Staaten gab es Restriktionen, denen man sich unterwerfen musste. Hatten Sie als Autor das Gefühl, in einem der Länder weiter gehen zu dürfen mit ihren Schriften?
L.M.: Man sagt immer, dass Ungarn eine weichere Diktatur als die DDR war, dort sei die Unterdrückung geringer gewesen als in Rumänien, der Tschechoslowakei, der DDR und so weiter. Das mag sogar stimmen, aber in Ungarn war ich Zuhause und war als ungarischer Staatsbürger unterdrückt. In der DDR war ich ein Fremder. Man erwartete von mir weniger Loyalität als von einem Einheimischen, weil ich mich in den dortigen Verhältnissen weniger auskannte bzw. vorgeben konnte, weniger zu wissen. Das war schon eine Möglichkeit, ein Zugang zur inneren Freiheit.
Was die ungarischen Verhältnisse betrifft: Ich bin 1959 geboren, das heißt, ich habe 30 Jahre in der ungarischen Volksrepublik verbracht. Die Jahre meiner Kindheit waren die Jahre der sogenannten Konsolidation, in der der staatliche Terror plötzlich nachgelassen hatte. Dann erlebte ich die frühe Phase der Kádár-Ära, gefolgt von der reifen und der überreifen Phase. Als ich mit 20 Jahren mit dem Schreiben anfing, traten wir gerade von der reifen in die überreife Phase über. Da kümmerte sich der Staat kaum mehr um die Ideologie. Wichtiger war, dass sich der Staatsbürger loyal verhielt. Auch in der Kulturpolitik war eine gewisse Nachlässigkeit spürbar. Der Staatsapparat, sogar der Parteiapparat, war nicht mehr marxistisch. Es war ein Parallelprozess. Sowohl die damalige Opposition, als auch die Staatssicherheit distanzierten sich vom Marxismus. Die Parteifunktionäre nahmen die Ideologie nicht mehr ernst. Die Systemkritiker – die Revisionisten, Maoisten und Populisten – waren Ende der 1970er Jahre junge Erwachsene, waren also durchschnittlich 10 bis 15 Jahre älter als meine Generation. Ich bin in das System, aber auch mit dieser Bewegung aufgewachsen. Der Grund dafür, dass ich kein Oppositioneller wurde, hängt nicht nur mit meiner Natur zusammen, sondern auch damit, dass die Szene von der älteren Generation besetzt war. Einerseits wollte ich vor allem schreiben und andererseits hatte ich, ehrlich gesagt, nicht den Mut, öffentlich politisch aktiv zu werden. Ich hatte zwar eine sehr ausgeprägte Abneigung gegen die Kádár-Ära, aber ich wollte nach dem Studium eine Arbeit finden und diese dann behalten. Ich wurde Verlagslektor, aber in die Partei einzutreten kam für mich nicht in Frage. Andererseits habe ich für die Untergrund-Presse keine Artikel geschrieben, nicht nur aus Mangel an Mut, sondern auch deshalb, weil mir nichts dazu einfiel. Ich habe Erzählungen und Dramen geschrieben. Heute würde mir schon einiges einfallen, nachdem ich mich mit diesen Problemen intensiv auseinandergesetzt habe.


n.: Sie haben gerade Ihre Position im damaligen System beschrieben. Welche Erfahrungen haben Sie denn im Umgang mit anderen Autoren gemacht, z.B. im Helikon-Verlag?
L.M.: Im Helikon-Verlag habe ich keine Erfahrungen mit Autoren gemacht. Ich habe den Helikon-Verlag gewählt, oder der Helikon-Verlag hat mich gewählt, damit ich auf diese Weise nichts mit der zeitgenössischen Literatur zu tun habe. Ich habe mich mit Kulturgeschichte beschäftigt und mittelalterliche Denker lektoriert. Ich wollte mit keinem Autor aus einer Machtposition heraus zusammenarbeiten, ich wollte keine Zensur ausüben. Wenn ich mit einem jungen Übersetzer zusammenarbeitete, der die Epigramme des Angelus Silesius übersetzt hatte, und ich meine Ansichten über die Alexandrinerzeilen äußerte, war das keine politische Entscheidung, das konnte ich mit reinem Gewissen machen. Aber wenn ich als Lektor einem jungen Autor gesagt hätte, die Erwähnung der Oktoberrevolution 1956 ist an dieser Stelle nicht angebracht, dann hätte ich mich kompromittiert gefühlt.
Aber als Schriftsteller machte ich meine eigenen Erfahrungen mit anderen Autoren, mit Generationsgenossen und auch mit älteren. Ich habe Autoren kennengelernt, die damals noch in einer inneren Emigration lebten und meine Entwicklung stark beeinflusst haben. In Ungarn gab es damals drei Kategorien von Autoren, die sogenannten „drei T’s“: Támogatott – die Geförderten, Tüt – die Geduldeten, Tiltott – die Verbotenen. Die geförderten Autoren existierten eigentlich nicht. Sie wurden sogar von der Partei tief verachtet, aber sie wurden trotzdem gefördert, weil sie der offiziellen Parteilinie folgten. Sie sind nicht einmal erwähnenswert, sie sind inzwischen vergessen. Die geduldeten Autoren bildeten ein breites Spektrum. Für sie wurde ein großer Topf vorbereitet, weil sie sowohl nach dem Geschmack als auch der Weltanschauung, der Gattung und dem Temperament ganz verschieden waren. Sie waren keine offenen Systemkritiker und suchten keine Konfrontation mit dem System, wollten aber auch nicht mitmachen bzw. keine Mitläufer werden.
Und dann waren da noch die wenigen verbotenen Autoren, die politische Dichtung verfassten. Sie waren von den Machthabern sehr gefürchtet, wie z.B. György Petri, István Eörsi oder György Konrád; oder die Populisten, die ebenfalls verboten waren: Gáspár Nagy und Sándor Csoóri. Diese suchten immer die Konfrontation und durften entweder überhaupt nichts oder teilweise nicht veröffentlichen. Manchmal wurden sie für eine Periode geduldet, später wieder verboten und so weiter. Das gehörte zu den Machtspielen.
n.: Mit Ihrem Wissen von heute, wie schätzen Sie die Handlungs- und Spielräume von Autoren in autoritären Regimen ein?
L.M.: Ungarn war, das muss ich mit Bedauern sagen, nicht der schlechteste Ort für oppositionelle oder für nicht ganz loyale Autoren. Es gab einige tabuisierte Themen, z.B. die Revolution 1956 oder die nationalen Minderheiten in den Nachbarstaaten. Aber ansonsten interessierte sich die Zentralmacht immer weniger für die Literatur und es entstand eine relativ große Freiheit. Das bedeutete auch, dass man kein Held oder Märtyrer sein musste, um anständig zu sein. Es gab Kriterien für Anständigkeit und Unanständigkeit. Ich konnte mich als junger Autor ziemlich genau daran orientieren: Eine Doktorarbeit über einen deutschen Barockdichter zu schreiben statt die marxistisch-leninistische Universität zu besuchen, bedeutete eine ehrliche Entscheidung, die aber überhaupt nicht heldenhaft war. Und wenn jemand diese verdammte Universität besuchte, wurde er dadurch auch nicht kompromittiert. Das war eine wesentlich seichtere Jauchengrube als z.B. ein inoffizieller Mitarbeiter zu sein, aber immerhin eine Jauchengrube.
n.: Sie haben nicht nur Erzählungen und Romane geschrieben, sondern auch deutsche Werke ins Ungarische übersetzt. Wie hat Ihnen die Arbeit als Übersetzer bei Ihrer Arbeit als Schriftsteller geholfen?
L.M.: Die Übersetzungen waren für mich immer Masken. Ich habe es immer genossen, Sätze eines Anderen niederzuschreiben, die doch auch meine Sätze sind. Oder Texte zu schreiben, für dich ich nur sprachliche Lösungen finden musste, weil die Handlung und die Werkstruktur schon von einem Anderen erfunden worden sind. Das war eine Art Erholung für mich. Die Flucht in den deutschen Barock war einerseits eindeutig eine Erweiterung meiner geistigen Welt, teilweise aber auch ein Fluchtweg vor den politischen Provokationen und dem ziemlich tristen Alltagsleben im Sozialismus. Aber die Maskenfunktion ist nach wie vor geblieben. Später in den 1990er Jahren, als ich an Erfahrungen reicher geworden war, wurde es mir immer wichtiger, einen Dialog mit dem toten Autor anzufangen. Das war schon bei meiner Faust-Übersetzung so, aber Goethe war weniger ansprechbar als Kleist, der auf skurrile oder makabere Weise mein Freund wurde.
n.: Sie übersetzen aus dem Deutschen. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zur deutschen Sprache beschreiben?
L.M.: Die deutsche Sprache ist meine Wahlsprache. Ich bin nicht wirklich zweisprachig, und wenn ich müde bin, oder nicht ganz genau aufpasse, mache ich grammatische Fehler oder bin stilistisch nicht ganz genau. Im Alltagsleben und insbesondere, wenn ich nicht zu Hause, sondern wie jetzt in Berlin bin, dann ist die deutsche Sprache mein Bewegungsraum. Die deutsche Sprache verhalf mir irgendwie zu einem Stück innerer Freiheit. Als ich Soldat war, wurde ich zur Strafe zum Wachdienst eingeteilt. Einen Monat lang musste ich nachts Wache halten. Es war sehr kalt, denn es war Winter. Und in der Zeit, die mir zur Verfügung stand, las ich einen deutschen Text mit Hilfe eines Wörterbuchs und schrieb mir die unbekannten Wörter raus. Dafür hatte ich immer eine halbe Stunde Zeit, nach der Ablösung, fünf- oder sechsmal am Tag. Anschließend befestigte ich das Blatt Papier mit einem Nagel an einen Baumstamm oder einer Planke und als ich so auf und ab spazierte, prägte ich mir dabei die Wörter ein. Ich hätte die Schlaflosigkeit sonst nicht ertragen. Und die deutsche Sprache hat mir über diesen schwierigen Zeitabschnitt hinweg geholfen. Später ist mir die deutsche Sprache ein Tor zur Weltliteratur, zur Philosophie geworden. Es gab sehr viele Werke, die ich nur in deutscher Übersetzung lesen konnte. Und noch später fing ich an, deutschsprachige Texte zu verfassen. Ich schreibe grundsätzlich in meiner Muttersprache, aber es kommt vor, dass ich mit dem Deutschen experimentiere.
n.: Sie haben ihre Romane auf Ungarisch verfasst, haben diese aber von Anderen übersetzen lassen…
L.M.: Ja, meine Romane selbst zu übersetzen, dazu wäre ich nicht fähig gewesen. Nicht nur, weil mir dazu die muttersprachliche Kompetenz fehlt, sondern auch deshalb, weil mir auf Deutsch ganz andere Sachen einfallen als auf Ungarisch.
n.: Wie gefallen Ihnen die deutschen Übersetzungen Ihrer Bücher?
L.M.: Ja, das ist anders als mit den slowakischen, bulgarischen oder mongolischen Übersetzungen, wo ich nur begeistert und gerührt sein kann [lacht], wenn ich mir meine Sätze anschaue, die doch nicht meine Sätze sind. Bei den deutschen Übersetzungen ist es anders, weil ich die Sprache verstehe, selbst übersetzerische Erfahrung habe und die Originalabsichten des Verfassers ziemlich genau kenne. Da ich ganz genau weiß, woran er gedacht hat, birgt das tatsächlich eine Gefahr für meine Übersetzer und Übersetzerinnen. Andererseits bin ich mit der deutschen Fassung aller drei Romane sehr zufrieden.
n.: Inwiefern ist es überhaupt möglich, gewisse kulturelle Kontexte in eine andere Sprache zu übersetzen? Und mit welchen Schwierigkeiten oder Problemen sahen Sie sich als Übersetzer konfrontiert?
L.M.: Das hängt von vielen Faktoren ab: von der Zeit des Kunstwerks, von der Kultur, die nicht unabhängig von der Epoche ist, vom Autor und Werk, von der Problematik des Werkes und nicht zuletzt von der Gattung. Vielleicht ist das das Wichtigste und darüber redet man relativ wenig. Der Übersetzer eines Gedichts, also eines lyrischen Werks, hat ganz andere Aufgaben und Probleme als der Übersetzer eines Prosawerks. Es ist eine immer noch offene Frage, ob man metrisch übersetzen sollte, ob man die Metrik nachahmen sollte oder nicht. In der ungarischen Literaturtradition ist es immer noch eine Sitte, die Metrik nachzuahmen. Wenn ein Gedicht in Hexametern verfasst wurde, dann muss auch die Übersetzung in Hexametern geschrieben werden. Nur dass ein ungarischer Hexameter ganz anders aussieht als ein deutscher. Die deutsche Metrik ist eine akzentuierende Metrik und die ungarische Metrik ist teilweise alternierend, teilweise aber qualitativ. Bei uns gibt es wie bei den Römern und Griechen einen eindeutigen Unterschied zwischen langen und kurzen Silben. Jedes Wort wird auf der ersten Silbe betont. Ein lyrischer Übersetzer muss ein Gedicht als Gedicht rekonstruieren, indem er es erst zerstört und dann in der Muttersprache oder Zielsprache rekonstruiert. Und manchmal hat man das Gefühl, dass man durch die Übersetzung etwas vom Dichter selbst und den Ideen, die dem Gedicht vorausgegangen sind, verstanden hat. Bei der Übersetzung von Hölderlin, bei komplexen und vielschichtigen Gedichten war das häufig der Fall. Ein paar Mal habe ich auch ein Fiasko erlitten, ich konnte das Gedicht von Nietzsche “Aus hohen Bergen” nicht übersetzen. Es gab schon eine ältere ungarische Übersetzung und dort stimmte die Metrik so ungefähr, die Reime waren da, nur dass die Zusammenhänge fehlten. Mir war klar, dass ich es vielleicht um einen Grad besser machen könnte, aber trotzdem würde es ein Fehlschlag werden. Und dann habe ich mich für eine Linearübersetzung entschieden und es wurde ein Fiasko, aber ich konnte nicht anders.


n.: Auf was muss man demnach bei der Übersetzung von Prosatexten achten? Und wie ist es mit den Dramentexten, die dazu noch bühnentauglich sein müssen?
L.M.: Bei Prosaübersetzungen muss man nicht so sehr auf die Handlung achten, die ist schon erfunden. Aber wesentlich ist, wie viel Hintergrundwissen der Übersetzer hat. Wenn jemand zum Beispiel Döblins Alexanderplatz übersetzt, dann muss er nicht nur die deutsche Sprache beherrschen, sondern sich auch in der Topographie Berlins, und zwar des damaligen Berlins gut auskennen. Er muss mit der Geschichte der Weimarer Republik und eine Menge anderer Dinge wie der Berliner Mundart vertraut sein, sonst wird er das Buch nicht gut übersetzen. Außerdem muss er den Atem des Romans nachahmen. Diese Probleme sind mehr oder weniger zu meistern. Man kann nicht erwarten, dass alles vom Originalwerk hundertprozentig herüber gerettet wird, aber wenn 80 oder 90 Prozent übertragen werden können, dann ist das schon sehr gut. Dabei geht es jedoch nicht nur um Nachahmung, sondern auch um das Schaffen eines selbständigen Werks. Das gilt für alle Gattungen, so zum Beispiel auch für das Theater.
Bei den Bühnenübersetzungen muss der Text bühnentauglich sein und das bedeutet, dass man für das Publikum, aber eigentlich auch für die Schauspieler und noch eigentlicher für den Regisseur übersetzt [schmunzelt]. Da kann man keine Fußnoten hinzufügen. Man kann nicht am Rand der Bühne stehen und erklären, dieser Hinweis bedeutet dies und jener das und an dieser Stelle hat das Publikum vor 400 Jahren gelacht. Nein, alles muss sofort funktionieren. Und deshalb ist eine philologische Treue häufig ein Hindernis für das Verstehen. Anderseits, und das ist meine Meinung, muss auch eine Bühnenübersetzung eine Übersetzung sein und keine Überarbeitung des Stücks. Ein talentierter Theaterautor kann aus den Motiven von Shakespeare ein Stück schreiben, wie Botho Strauß zum Beispiel. Das ist völlig legitim, aber das ist keine Übersetzung. Doch wenn jemand König Lear oder Hamlet neu übersetzt, dann müssen auch sämtliche Lösungen und Entscheidungen philologisch untermauert sein. Es gehört auch zur Problematik der Übersetzung, dass die Übersetzungen sehr schnell veralten, anders als die Originalwerke. Warum dem so ist? Das zu erklären, wäre eine Geschichte für sich.
n.: Dann lassen Sie uns noch ein wenig über Ihr literarisches Werk sprechen. Was an den großen drei Romanen auffällt, ist der Vergangenheitsbezug. Es sind Geschichten, die teilweise Jahrhunderte zurückliegen, wie in Versteck der Minerva oder in Die wahre Geschichte des Jacob Wunschwitz. Was interessiert Sie an diesen Zeiten?
L.M.: Das ist eine nunmehr abgeschlossene Epoche in meinem Leben und Werk. Zu der Zeit, als ich aufhörte, ein junger Autor zu sein, und mehr oder weniger als reife Persönlichkeit schrieb, da fiel mir auf, dass die Historie sehr viel Bewegungsraum für die Fantasie bietet. Das versuchte ich auszunutzen. Mich interessiert nicht die Vergangenheit als solche, denn ich bin kein Museologe, weder Museologe noch Archäologe, noch Antiquar. Nein, mich interessieren immer die Ansätze der Gegenwart, das heißt die Ansätze des modernen Menschen, die Ansätze oder die Vorgeschichte unseres heutigen Zustands. Und ich habe entdeckt, dass in der frühen Neuzeit das moderne Individuum schon mehr oder weniger fertig ausgebildet war. Das war auch ein Entstehungsprozess. Mich interessierte die damals gesprochene Sprache, die wir zwar nicht mehr sprechen, aber mehr oder weniger noch verstehen. Mich interessierten auch die Verhältnisse des 16.–18. Jahrhunderts, sowohl die politischen als auch die kulturellen. Wenn sie auch nicht identisch mit den heutigen Verhältnissen sind, da, wie bereits gesagt, die Kluft immer größer und größer wird, bleiben sie dennoch vergleichbar. Die damaligen Verhältnisse waren roher und primitiver als heute, die Arbeitsteilung war nicht so ausgeprägt und persönliche Entscheidungen spielten eine wesentlich größere Rolle als heute. Und gerade deshalb versuchte ich Geschichten zu finden oder zu erfinden, in denen sich der heutige Leser wieder erkennen kann und dennoch nicht sich, sondern etwas Fremdes findet.
n.: Demnach geht es um die Spannung zwischen Fremdheit und Vertrautheit…
L.M.: Genau. Die erste Hälfte meines ersten historischen Romans Die wahre Geschichte des Jacob Wunschwitz des Romans entstand hier in Berlin, und zwar am Wannsee im Gebäude des LCB, des Literarischen Colloquiums Berlin, und sie weist zahlreiche Bezugspunkte zu Heinrich von Kleist auf. An dem Ort an einem kleistisch angehauchten Roman zu arbeiten, wo sich Kleist selbst erschossen hatte, war schon teilweise schrecklich, anderseits anregend und inspirierend. Ich wollte an einem Stoff arbeiten, den Kleist ganz gewiss gekannt und trotzdem nicht verwendet hatte. Eine Klageschrift der Witwe des im Titel vorkommenden Jacob Wunschwitz taucht in derselben Sammlung auf, in der auch die Geschichte von Kohlhaas vorkommt. Kleist hat ganz gewiss die gesamte Sammlung gelesen.
n.: Im Versteck der Minerva enthüllt der Erzähler an einer Stelle, dass das Prinzip der Verzögerung sowohl grundlegend für das Leben an sich sei, als auch, wie man als Leser später feststellt, für das Werk eine entscheidende Rolle spielt. Inwiefern ist das Prinzip der Verzögerung für Ihren Roman fruchtbar gewesen?
L.M.: Eines Tages müsste man eine Poetik der Verzögerung schreiben. Je älter ich werde und je mehr Bücher ich schreibe, desto sicherer bin ich, dass einer der grundsätzlichen Faktoren der erzählenden Prosa die Verzögerung ist. Denken Sie nur daran, wie Tausend und eine Nacht strukturiert ist. Es ist ein Riesenwerk, in der ungekürzten Fassung zehntausend Seiten lang und das einzige poetische Prinzip, das erzählpoetische oder romanpoetische Prinzip, das ganz konsequent durchgeführt wird, ist die Verzögerung. Die Verzögerung ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, eine tragfähige narrative Struktur zu entwickeln. Doch wenn man an die Einschübe, die Exkurse, Meditationen, Landesbeschreibungen, Bildbeschreibungen und Interieurs in den gelungensten Erzählwerken denkt, die nicht nur als Kolorit funktionieren, sondern meistens eine sehr wichtige Schicht des Textes darstellen, dann würde ich sagen, dass man auf die Verzögerung nicht verzichten kann. Man kommt nicht umhin zu verzögern, weil eine jegliche Reflexion, eine jegliche Erklärung, eine Anrede des Lesers, ein Spaß, ein Hinweis an sich eine Verzögerung ist. Es gibt Autoren, die die Verzögerung hundertprozentig auszuschalten versuchen. Das finde ich keine glückliche Bestrebung. Andererseits muss man ein klares Konzept haben. Man muss kommandieren. Und manchmal muss man dabei auch energisch vorgehen. An gewissen Stellen muss man große und schnelle Schritte vornehmen. Das gehört auch dazu. Wenn es nur Verzögerung gibt, dann kann man das Werk nicht abschließen.
n.: Eine letzte Frage. Sie hatten mal erwähnt, dass es für Sie als ungarischen Schriftsteller schwerer sei, sich im literarischen Betrieb zu behaupten. Inwiefern ist das so und was sind die Gründe dafür?
L.M.: Das habe ich tatsächlich gesagt, aber das bezog sich nicht auf meine Identität als ungarischer Autor, sondern überhaupt auf mich als László Márton. Ich bin daran gewöhnt. Mein Vater war Zahntechniker und das bedeutete, dass er selbständig war. In der Schule gab es sechs verschiedene Kategorien von A bis F. Wer A war, der hatte Arbeitereltern. Wer B war, der hatte Eltern, die zur Arbeiterintelligenz gehörten. Wer C war, hatte Eltern in der Landwirtschaft usw. Und von A bis E hatten die Kinder ab den 1970er Jahren schon ungefähr die gleichen Chancen. Aber Kategorie F war eindeutig ein Handicap. Mir ist dann klar geworden, dass ich mit diesem Buchstaben nicht so ohne weiteres an der Uni angenommen werden würde. Meine einzige Chance oder Möglichkeit, Hungarologie zu studieren, bestand also darin, durch einen Wettbewerb an die Uni zu kommen. Es gab jedes Jahr einen Wettbewerb für Gymnasiasten in sämtlichen Disziplinen und ich musste in der Kategorie ungarische Literatur gewinnen. Ich wusste also, dass ich unter die ersten zehn kommen musste, und ich wurde vierter mit einem Aufsatz über Thomas Mann. Das ging dann auch in der Literatur so weiter, weil ich kein bequemer Autor bin, weil ich nie populär werden oder mich dem Mainstream anschließen wollte, sondern meinen eigenen Weg beschritt. In den ersten fünf, sechs Jahre meiner literarischen Laufbahn wurden alle meine Manuskripte von den damaligen Literaturzeitschriften abgelehnt. In dieser Zeit musste ich mich entscheiden, ob ich trotzdem weiter schreiben wollte. Ich habe weiter geschrieben und dann wurde mein erster Erzählband angenommen. Noch später wollte ich auf Deutsch veröffentlicht werden und musste deshalb eine Erzählung auf Deutsch verfassen. Meine Bücher waren damals nicht gefragt und wurden nicht übersetzt. Später dann schon. Ich bin mit der Kategorie F aber gar nicht unzufrieden. Könnte ich es anders machen, würde ich es nicht tun.
n.: Vielen Dank!


