

Das lange und schwierige 20. Jahrhundert in zwei sehr unterschiedlichen literarischen Erkundungen
Anna Boleckas Uwiedzeni (Die Verführten) und Inga Iwasióws Bambino
Was beide Romane verbindet, ist die Geschichte, die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Bei Bolecka das erste schwierige von Faschismus und totalitärem Denken geprägte Drittel zwischen Wien, München und Danzig, konkret zwischen 1909–1938, und bei Iwasiów das längere zweite Drittel, gleichsam das ungewollte polnische Erbe dieser zerstörerischen Geschichte, wie es sich in der polnischen Nachkriegsgeschichte präsentiert, die von der Autorin aber nur bis 1981 verfolgt wird. Was die Texte auch verbindet, ist das Geschlecht der Autorinnen, die Zugehörigkeit zur Frauenliteratur, genauer zur neuen Frauenprosa, die sich nach 1989 entschieden in die Mitte der polnischen Prosa rückte und sich inzwischen längst über den schwachen gemeinsamen Nenner ‚Frau‘ hinausentwickelt und ausdifferenziert hat, so dass man den Begriff Frauenliteratur kaum mehr aufnehmen will. Die Besinnung auf die Geschichte ist nicht neu in der Frauenliteratur. Izabella Filipiak, Olga Tokarczuk und vor allem Anna Bolecka selber hatten bereits früher historische Erkundungen vorgelegt. Was neu ist, ist die unbedingtere Konfrontation mit der politischen Geschichte.
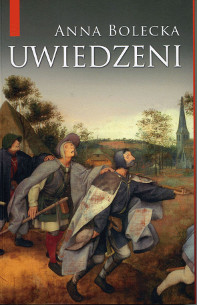
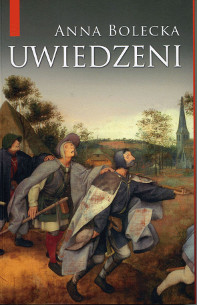
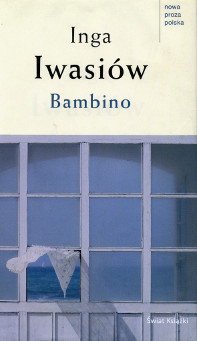
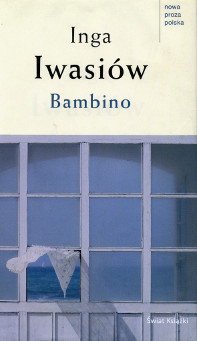
Was die beiden so unterschiedlichen Vertreterinnen aktueller polnischer Prosa überraschend eint, ist das Delegieren der Erzählstimme auf die Stimmen der Helden, genauer das Nachzeichnen authentischer historischer Diskurse, wie sie vor über 40 Jahren die linguistische Prosa in Polen als eine der wichtigsten alternativen Erzählformen gegen die offizielle und offiziöse Literatur erprobte. Der Umgang mit der referierten lebendigen Rede, seine Funktion im Erzählen, ist bei den beiden Autorinnen verschieden, er ist auch verschieden von seiner polnischen Urform in den späten 60er Jahren bei Białoszewski oder den Vertretern der Nowa Fala.
Bolecka organisiert in Die Verführten ihren historischen Abriss in fünf Teilen, fünf Tableaus, wobei das mittlere, das polnische, zweigeteilt ist und wir sechs Kapitel erhalten. Jedes von ihnen zeichnet ein Tableau eines Verführten, hingerissen von seinen eigenen Idealen, Phantasien oder Projektionen, die sich im postmetaphysischen Jahrhundert ins Absolute steigern, steigern müssen. Von diesen fünf Porträts von Enthusiasten berühren die drei Männerporträts direkt die Geschichte des deutschen Faschismus. Die zwei Frauenporträts stellen sich jedoch genau gegen diese Geschichte, und zwar im Porträt einer deutschen Stigmatisierten auf einem Dorf in Bayern und im zweiteiligen Porträt einer polnischen Morfinistin und existentialistischen Dichterin aus Danzig, die Stanisława Przybyszewska nachgebildet ist. Bei den drei Männerfiguren zeichnet das erste Porträt eine zwar fingierte, aber gleichzeitig stark authentische Hitlerfigur in Wien vor dem Ersten Weltkrieg nach und das dritte den SS-Untersturmführer Erich Vogel, einen Homosexuellen und Mythenforscher, der einen gefährlichen Weg zwischen Konformismus und privatem Außen zu gehen versucht. Zwischen diesen beiden historischen Figuren steht der deutschstämmige Peter, der aus Polen kommt, der Hauptprotagonist, der die vier Porträts oder historischen Erfahrungsbilder zusammenhält und als Soldat in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs an der Westfront auch eine eigene Porträtskizze erhält.
Bolecka wandelt in ihren Verführten Hermann Brochs Schlafwandler von 1930/32ab, das in Polen eine sehr intensive Rezeption erhalten hat. Die gefeierte szenische Adaption durch den Regisseur Krystian Lupa in den 90er Jahren legt davon ein spätes Zeugnis ab. Brochs wichtiger Beitrag für das Erzählen der Moderne entsteht aus der spezifischen Form des intellektuellen Erzählens, aus der Integration des Essays in die Fiktion. Genau diese metafiktionale Außenposition, die Milan Kundera an Broch so schätzte und die er vielfach in seiner Erzählwelt adaptierte, nimmt Bolecka nicht auf. Bolecka delegiert die intellektuelle Reflexion zunächst an Peter, eine Figur im Roman, die uns an den verschiedenen Porträts entlang führt. Bolecka rekonstruiert ihre parahistorischen Figuren, insbesondere das Porträt des jungen Hitlers und das Doppelporträt von Stanisława Przybyszewska kurz vor ihrem Selbstmord, aus verschiedenen zeitgenössischen Quellen und sie nennt uns ihre Quellen im Anhang selber. Die Nachzeichnung operiert mit der Montage von authentischen oder fingierten Redesequenzen. Bolecka legt die erzählerische Rekonstruktionsarbeit aber nicht frei, sondern täuscht Unmittelbarkeit vor, und das intellektuelle Verstehen wird letztlich auf den Leser verschoben, der sich mit keiner der fünf Figuren identifizieren kann. Boleckas Verzicht auf ein reflexives Außen, ein intellektuelles oder erzählerisches, schafft vor allem bei den Figuren des Faschismus – zumindest für einen deutschen Leser – eine ungeschützte oder naive Nähe, die schwer erträglich ist.
Der Roman will aber nicht nur beschreiben, er will das historische Phänomen auch verstehen, indem er verschiedene Formen faschistoiden Denkens und Daseins einander gegenüberstellt und in den fünf Figuren sehr heterogene Formen radikaler, ins Totalitäre gesteigerter Existenz miteinander konfrontiert, Existenzen, die von ihren Ideen oder Phantasmen unkritisch erfasst und ergriffen sind. Diese fünf Porträts präsentieren sich jedoch zu singulär und jeweils in sich abgeschlossen, so dass Peter, der die vier anderen Zeitfiguren in seiner Lebensgeschichte und in seinem Verstehen verbinden sollte, darob zur reichlich strapazierten künstlichen Figur wird. Die fünf individuellen Zugänge, weil sie einen so großen Zusammenhang suggerieren, müssen sich vor der noch heute erdrückenden historischen Wahrheit des Faschismus als ungenügend zu erkennen geben. Da hilft auch die deutliche Beschränkung des Erzählens auf die Herausbildung des Faschismus, auf das nur faschistoide Denken und das weitgehende Ausklammern der faschistischen Tat, nicht wirklich. Vor allem weil sie auch nicht konsequent umgesetzt wird, wie das letzte Porträt zeigt. Dort wird die ganz andere Welt, der totale Terror eines Lageralltags, beschrieben, in der das private Bekenntnis zur Homosexualität eines ‚unechten’ SS-Offiziers ins Melodramatische und Theatralische auswachsen muss. Nur so kann das Inkommensurable von Öffentlichem und Privatem vorgeführt werden. Das alles wäre schließlich kein Problem des Romans, wenn dieses Versagen des Erzählversuchs im Erzählen selber seinen Ausdruck bekäme, d.h. in der Zeichnung Peters. Peter, der das Böse und das Gute der Zeit in sich vereinen soll, kann als Führer durch die Porträtgalerie am Vorabend des Zweiten Weltkriegs dieser Verstehensarbeit aber keinen – zumindest individuellen – Grund geben.
Das nur additive Außen Peters wird vor allem in diesem letzten, etwas forcierten, Porträt eines jungen Homosexuellen deutlich. Erich Vogel sucht, erschreckt von der Repression gegen die Homosexuellen, bereits in den späten 30er Jahren eine Strategie von Anpassung und individueller Exkulpierung zu verfolgen. Er befreit, in einer wenig plausiblen Form, Peter aus dem Gefangenenlager, und sucht in seiner Beichte vor Peter, für die wir bis in den Süden Frankreichs reisen müssen, dessen Verständnis für sein von der Zeit ihm aufgezwungenes abstoßendes Verhalten. Bolecka verstrickt sich hier in die Fänge eines bekannten Prätextes. Andrzej Kuśniewicz hat in seinem frühen Roman Eroica, geschriebenin den 60er Jahren, die polnische Urfigur dieses etwas dekadenten, elitären jungen Deutschen in den Fußstapfen von Stefan George geschaffen. Die Innenperspektive, im inneren Fieber-Monolog des verhafteten Mitläufers am Ende des Kriegs in Frankreich umgesetzt, dominiert den Roman, bricht sich aber in der nur indirekt erschlossenen historischen Außenperspektive. Dabei wird die Lebenslüge des Anderen, des Homosexuellen, in den Fängen der Geschichte entlarvt und die dekadente Verbrämung entzaubert. Die Schwierigkeit vom Erzählen des Faschismus – und hier erschwerend auch noch aus der Perspektive der von ihm Verführten und nicht, wie für die polnische Prosa vorgegeben und mehrheitlich eingeübt, seiner Opfer – findet sich bei Bolecka nicht. Allerdings gerät das Porträt des deutschen Homosexuellen in den 30er Jahren allzu faktographisch, es ist einem gut recherchierten Handbuchartikel nachgebildet.
Kuśniewicz, der Schriftsteller aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten (Kresy) und einst gefeierter Erzähler der nostalgisch verzauberten K. und K.-Kultur Galiziens und Ludomeriens, war immer Subjekt und Erzähler der Geschichte zugleich. Bolecka hat mit Der weiße Stein dieser primär von Kuśniewicz vertretenen Tradition der Kresy-Literatur ihren späten Tribut gezollt, sie ist bereits in diesem frühen Roman Nachfahrin, so wie sie in den aktuellen Verführten Nachgeborene ist. In ihrem jüngsten Roman erstaunt aber das Ausmaß der historischen Distanz, die sich gerade auch in der direkten Formel des Erzählens anzeigt. Darin geht sie über ihren frühen Kresy-Roman deutlich hinaus. Anna Bolecka beschönigt die Entstehung des Faschismus nicht, sie beschreibt ihn wie außerhalb des polnischen Kriegstraumas, das die Nachkriegsgenerationen noch lange prägen wird und für jemanden mit Jahrgang 1951 sicher keine fremde Erfahrung ist. In dieser neuen Haltung gegenüber der deutschen Geschichte, die auch mit eigener Geschichte, das Schicksal von Przybyszewska oder das für eine polnische Frömmigkeit sehr nahestehende Porträt einer jungen Stigmatikerin vom Land zusammengedacht werden kann, sehe ich eine zentrale Eigenart des Romans, die – bei allen (nicht nur deutschen) Vorbehalten insbesondere gegen die Poetik des Romans – nicht zu unterschätzen ist.
Iwasiów macht es uns in ihrer Darstellung von Geschichte leichter. Sie kämpft zugegebenermaßen auch mit weniger ästhetischen Widerständen in ihrer kleinen polnischen Nachkriegsgeschichte als Bolecka in ihrer großen Geschichte. Sie arbeitet aber auch, wie Bolecka, mit mehreren parallelen Lebensläufen. Im Zentrum stehen drei Frauen, die deutschstämmige Ula oder Ulrike aus dem Vorkriegsstettin und die beiden Übersiedlerinnen Marysia aus der Ukraine und Anna aus den Beskiden. Hinzu kommt als einzige gleichwertig männliche Nachkriegsbiographie die von Janek, der in der Nähe von Posen aufwächst. Diese vier Schicksale durchkreuzen und ergänzen verschiedene weitere Figuren, vor allem die beiden Kinder von Anna und Marysia und die Männer bzw. Freunde von Ula und Anna. Alle diese Figuren sind über den Ort Stettin und enger über den Klub bzw. das Restaurant Bambino in Stettin verbunden. Die einzelnen Personenstränge leben nicht gerade von einer aktionsreichen Lebensgeschichte, sie sind relativ stereotyp, sondern von den referierten Reden der Figuren untereinander oder mit sich selbst. Wir erhalten eine Art ‚kleinen Realismus’, der sich über die Kombination der Schnitte und die Gruppierung der Momentaufnahmen auf der Zeitachse von fast 40 Jahren Nachkriegsgeschichte auf die große Perspektive hin öffnet. Hier zeigt sich die eigentliche Handschrift des übergeordneten und autonomen Erzählers, der sich von Zeit zu Zeit auch aus der Zeit herausfallende allgemeine Bilder erlaubt. Das Resultat ist eine riesige Fototapete, ein Erinnerungspuzzle einer künstlich gebildeten Schicksalsgemeinschaft oder modernen Patchwork-Familie, die vom Ort Stettin und von der Privatheit lebt.
Die Nahaufnahme öffnet sich über verschiedene rekurrente Themen oder Motivketten, die die kleine Geschichte in die große transzendiert. Am wichtigsten sind dabei der weibliche Existenzentwurf und weibliche Versuche des Überlebens und des Sich-Neu-Einrichtens nach der Erschütterung durch Krieg und Vertreibung. Die Autorin hütet sich aber davor, diese neuen weiblichen sozialen Strukturen, die an der Stelle der einstigen patriarchalen Familienverbände entstehen und die von der neuen sozialistischen Ordnung deutlich nicht verhindert werden, zu verherrlichen und damit in die Falle feministischer Mythenbildung zu tappen. Die Lebensgeschichten der drei Protagonistinnen sind alles andere als Musterbiographien und die beiden polnischen Lebensläufe enden in der Erstarrung des Selbstmordes bei Marysia und der fetischisierten häuslichen Ordnung bei Anna. Die deutsche Ula versucht hingegen der nächsten Generation den Weg ins Erwachsenwerden zu ebnen – und dies in sich selber abgetrotzter pragmatischer Zurückhaltung.
Es ist überraschend, wie Ula, die Deutsche, die nach 1945 in Stettin bleibt und sich der oft an sie herangetragenen Suggestion der Familienzusammenführung in Ost- oder Westdeutschland verschließt, die über sich hinauswächst, zu einer Art stillem Mythos im Roman wird, in dem sich die Stadt Stettin, für die sie steht, und das Frausein – Ula ist kinderlos – verbinden. Dieses sympathische polnische Bild einer Deutschen erkauft sich weder über das in Polen überraschend oft eingesetzte Motiv des Kulturträgers, und noch über die ausgeliehene Figur aus der Romanwelt von Thomas Mann, die sie hätte adeln oder entschulden können wie in der jüngsten Danziger Prosa von Stefan Chwin und Paweł Huelle. Deutsche nationale Heterostereotypien erscheinen in der sehr lebensnahen Frauenfigur wie aufgelöst – so aufgelöst, dass Ula sogar eine der wenigen epischen Verdichtungen als Erzählfigur unbeschadet überlebt.
Diese originelle und facettenreiche Zeichnung der Frauenwelt war bei der Autorin zu erwarten, zur großen positiven Überraschung gerät aber ihr umgekehrter, anderer Blick auf die politische Situation der Nachkriegsgeschichte. Wir haben keine unerbittliche Abrechnung mit der sozialistischen Geschichte Polens vor uns, wie sie für die Solidarność-Generation, zu der die Autorin mit Jahrgang 1963 noch knapp gehört, typisch ist.
Bei der neuen und vor allem auch jungen Gesellschaft von Zuwanderern aus verschiedenen Regionen des ehemaligen Polens treffen sich Überlebenswille, Versuche des wirtschaftlichen Aufstiegs, des sog. sozialistischen ‚Awans‘, mit der neuen politischen Ordnung in einem zwar wenig ideologiefesten, aber umso langlebigeren Pragmatismus. Bambino ist kein Ort des Dissenses, und die verdrängten Seiten der deutschen wie der polnischen jüngsten Geschichte sind Sache der Väter, Brüder und Ehemänner. Die Frauen sind eher der, für die Zeit der Teilungen so typisch gewordenen, polnischen Frauenrolle der ‚Nationsbildung aus dem Hintergrund‘ entwachsen, genauer gesagt wissen sie nichts mehr von ihr. Anna verbindet ihr langsames und sich selber abgerungenes ‚Awans‘ mit Parteizugehörigkeit und heimlichen Kirchengängen, ohne bei beiden eine Identität zu finden. Sie bleibt trotz all ihren kleinbürgerlichen Versuchen, sich einzurichten, heimisch zu werden, sich und den anderen eine Fremde.
Die für die polnische Widerstandsgesellschaft seit Jahrhunderten eingeübte Dichotomie von Verrätern und Patrioten, guten und schlechten Polen ist in diesem Nahblick wie aufgehoben. In Bambino wird uns ohne Nostalgie und Kryptokommunismus der reale Sozialismus rekonstruiert, die kleine Stabilisierung unter Gomułka und Gierek und die sozialistische Vergangenheit in ihrem Alltagsgesicht verständlich gemacht und nahe gerückt. Es wird uns der Teil der polnischen Geschichte vergegenwärtigt, der nach 1989 in der öffentlichen Erinnerung wie ausgelöscht wurde und der bereits in der Massenbewegung der Solidarność erstmals von der Mehrheit bekämpft und abgelehnt wurde, darum muss historisch richtig die Geschichte von Bambino bereits 1981 enden, weil danach nur mehr das zu lange Warten auf das offizielle Ende des realen Sozialismus kommt, das bereits 1980 vollzogen war. In dieser Erinnerungsarbeit und fiktionalen Rekonstruktion einer verdrängten Zeit, die der Autorin für die Zeit nach 1956 deutlich besser gelingt, d.h. wo sich erinnerte Zeit und eigene Zeit immer mehr decken, als für die ersten Jahre nach 1945, liegt die vielleicht wichtigste und nicht zu überschätzende Leistung dieses Romans.
Vielleicht gerade wegen dieser Offenheit bzw. der inneren Nähe gegenüber dem realen Sozialismus wird dieser historische Rückblick alles andere als ein patriotischer oder gar nationalistischer. Iwasiów kann selbst den polnischen Katholizismus ohne Pathos, aber auch ohne Ironie zeichnen.
Vergleichsweise schwächer gelingt Iwasiów die Darstellung der über die gewaltigen Umsiedlungen entwurzelten Bevölkerung, genauer die Erinnerungsarbeit ihrer Helden an die ehemaligen Ostgebiete, die in der Kresy-Literatur nach 1956 zum wenn auch verkürzten großen Thema und zur großen erzählerischen Herausforderung wurde. Das Ukrainebild, das in der Erinnerung und in den Rückkehrversuchen Marysias gezeichnet wird, ist in Bambino korrekter und damit auch ein wenig stereotyper als authentisch gefasst und fällt weit hinter die von ihr in ihrer Dissertation einst polonistisch bearbeitete Erinnerungswelt Odojewskis zurück. Wenn der Blick in die andere Welt der Ukraine Iwasiów nicht gleich gelingt, hat das weniger mit dem Polonozentrismus der Nachkriegszeit als mit der Grenze der Poetik zu tun. Der ‚kleine’ Blick kann sich in der unmittelbaren und eigenen Welt entwickeln und die Ukraine ist in der polnischen Literatur seit je her unendlicher Raum und weite Perspektive. Iwasiów, Kind der zweiten Generation, ist deutlich in Stettin angekommen.
Die polnische Prosa hat nach 1956 lange ihre Autonomie gegenüber dem ‚fremden’ Staat vor allem in der Freiheit der Form und im literarischen Experiment gesucht und hat sich für diese ästhetische Unabhängigkeit in einen Elfenbeinturm sperren lassen, der ihre Verbindung zur Wirklichkeit kappte oder zumindest verkürzte. Die neue Prosa nach 1989 hat sich sehr rasch des Ballasts des einstigen, nicht immer authentischen literarischen, Experiments entledigt. Die neuen Zwänge, und sie werden sich bald als ebenso große entpuppen, werden ihr aus dem freien (Literatur)markt entstehen. 20 Jahre nach der Wende fällt auf, dass gerade die polnische Prosa ihren Leser sehr ernst nimmt und seiner Identitätssuche deutlich entgegenkommt. Der in den 60er und 70er Jahren von der Literaturkritik vergeblich geforderte Gesellschafts- oder Zeitroman wird erst jetzt geschrieben, vielleicht nicht in der alten Form eines großen Einzelwurfs, sondern demokratisch in vielen Einzelteilen. Iwasiów hat ein solches Einzelteil geliefert. Die Form, die sie dafür verwendet, ist nicht neu, erhält auch nicht den Selbstwert der 60er Jahre, aber die Authentizität der eigenen fast privaten Anwendung.
Bolecka kommt aus Warschau,dem Zentrum, Iwasiów aus Stettin, der Stadt an der Grenze. Bolecka macht sich auf die Suche nach der allgemeinen europäischen, aber auch ein Stück weit fremden Geschichte, Iwasiów nach der kleinen Geschichte, der Geschichte der eigenen Stadt. Boleckas Erzählform bleibt in ihrer Erkundung des Fremden in den engen und erprobten Grenzen einer traditionellen Erzählform, die den subjektiven Standpunkt fast ängstlich meidet. Iwasiów findet in Stettin nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch ihre eigene Form. Die Regionen sind offensichtlich auch heute noch Nährboden der polnischen Literatur.
Bolecka, Anna: Uwiedzeni. Jacek Santorski, Warszawa 2009.
Iwasiów, Inga: Bambino. Świat Ksiąki, Warszawa 2008.


