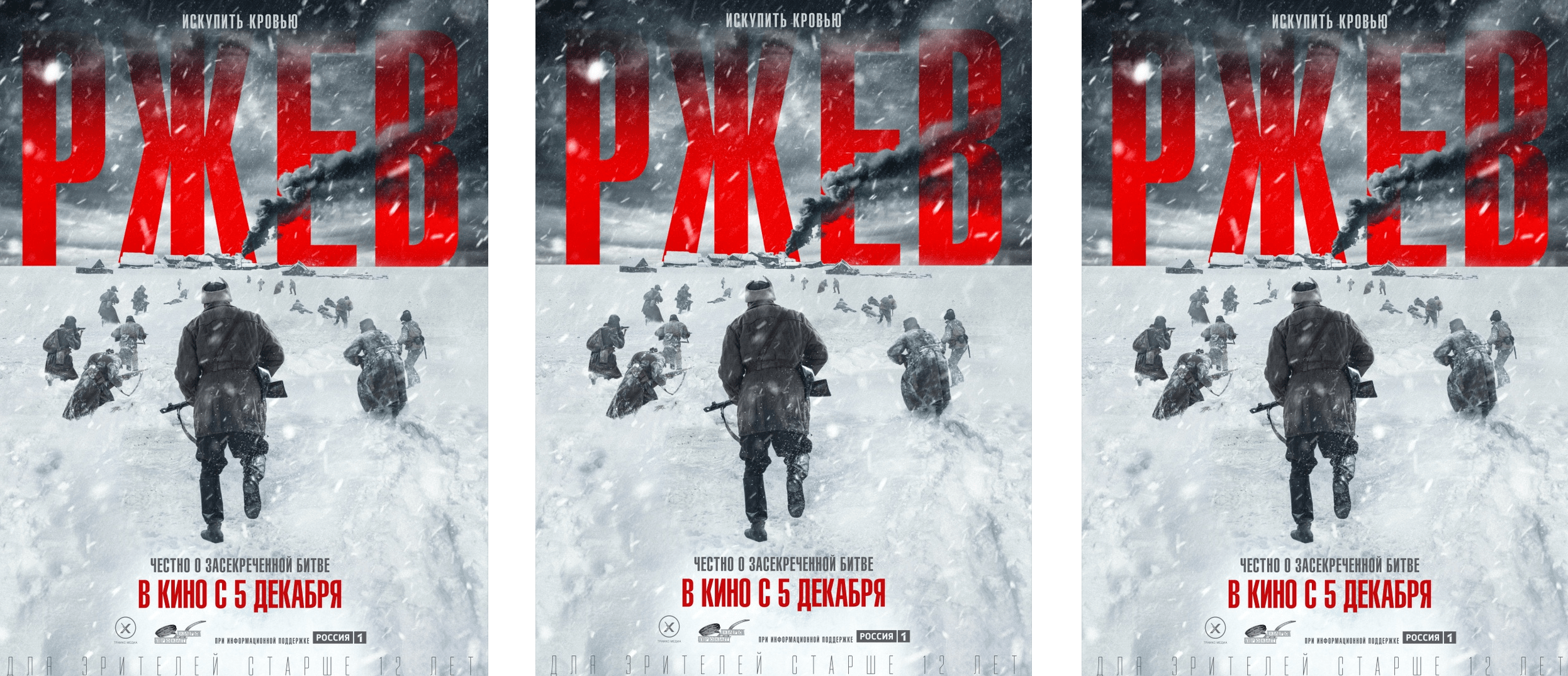
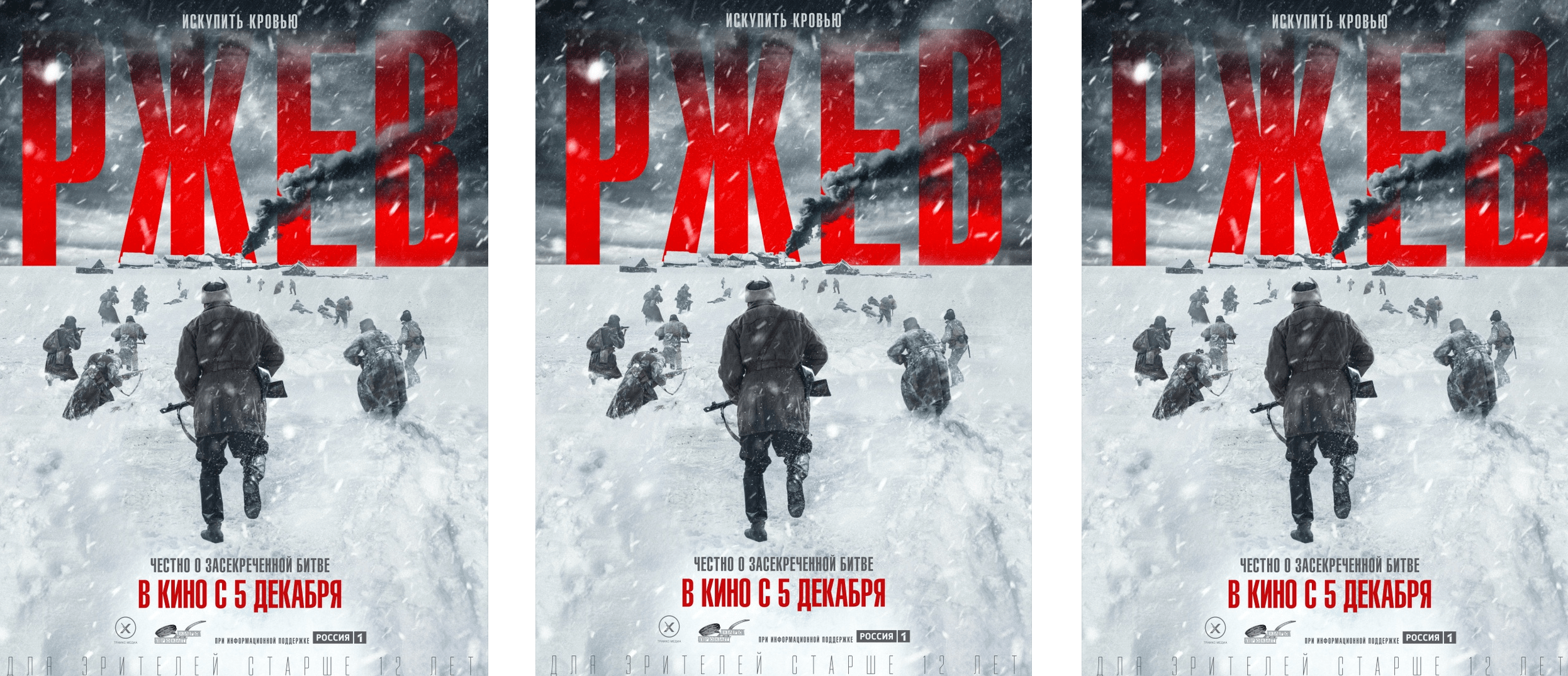
Ein Krieg im Krieg
Zwischen Actionkriegsfilm und Erinnerungsgeschichte(-n): Der russische Regisseur Igor Kopjlov nimmt mit “Ržev” (2019) die entscheidende Schlacht vor der Niederlage der deutschen Wehrmacht in Stalingrad zum Ausgangspunkt und wirbelt so den russisch-sowjetischen wie auch den gesamteuropäischen Erinnerungsdiskurs über den zweiten Weltkrieg wieder auf. Allerdings bleibt der Film dabei hinter seinem Potential zurück.
Kopjlov inszeniert die Schlacht um Ržev aus russischem Blick ungewöhnlich schonungslos-brutal, doch verbleibt er in einer nationalpatriotischen, verklärenden Sicht auf das sowjetisch-russische Heldentum. Die Asymmetrie in der europäischen Kriegserinnerung bleibt bestehen. Durch schwache Figurenzeichnung und oberflächliche Dialoge verhindert Kopjlovs Inszenierung der Schlacht von Ržev zudem eine empathische Teilhabe und einen notwendigen komplexen, differenzierteren Zugang zum Erinnerungsdiskurs. Dennoch: Die Schlacht von Ržev als Ausgangspunkt der Filmhandlung markiert zunächst eine andere, auch das Versagen in den Blick nehmende, russische Sicht – wenn auch in der Ambivalenz verweilend. Bereits in der Eingangsszene wird diese Ambivalenz in Ržev deutlich: Zwischen der künstlerischen Darstellung der Bilder und Figuren und dem erschütternden, historischen Anlass des Kriegsblockbusters.
Zweiter Weltkrieg, Ostfront, 1942: Die Offensive einer Roten Armee-Division. Die Rotarmisten stürmen auf ein kleines Dorf zu – es ist die Siedlung Ovsjannikovo, von deutschen Truppen besetzt, die zurückerobert werden soll. Das Schlachtfeld im Schnee ist eröffnet: Schüsse, Schreie, Granaten, abgetrennte Gliedmaßen – konterkariert von heiterer Gitarrenmusik. Das Bild ist gestochen scharf, fast schon artifiziell scharf, und erinnert an die hyperrealistische Ästhetik eines ‚modern military shooter‘. Die Rotarmisten haben kaum eine Chance, fast die Hälfte der Kompanie fällt für diese erste Etappe der Großoffensive. Hintergrund bilden die Kriegsereignisse um Ržev, angelehnt an eine Erzählung des russischen Schriftstellers Vjačeslav Kondratʹev. Kriegsereignisse, die bisher im kollektiven, russisch-sowjetischen (Kriegs-)Gedächtnis kaum einen Platz bekommen haben. Zwar als „Fleischwolf von Ržev“ („rževskaja mjasorubka“) oder „russisches Verdun“ in die Geschichte eingegangen und einen Wendepunkt an der Ostfront im zweiten Weltkrieg markierend, ist an die Schlacht um Ržev in Russland aufgrund hoher Verluste und massiver, unkontrollierter Planungen der Offensiven kaum erinnert worden. Doch gerade diese verlustreichen Kämpfe verhinderten den weiteren Vormarsch der deutschen Truppen nach Moskau und waren entscheidend für die spätere Niederlage der deutschen Wehrmacht in Stalingrad.


Es ist aber nicht nur die brutale Schlacht an sich, um die Igor Kopjlov seinen Film inszeniert: Nach der Offensive harren die geschwächten Soldaten – das heißt jene, die noch übriggeblieben sind – mit dem unwiderruflichen Befehl einer Großoffensive auf Unterstützung vor dem Dorf. Ein vergebliches Warten, denn die versprochenen Rationen an Essen und Munition kommen einfach nicht. Der Befehl des sowjetischen Oberkommandos bleibt dabei hartnäckig bestehen. Inmitten dieses Ausharrens wirft ein Flugzeug der deutschen Wehrmacht Flugblätter ab, die Passierscheine enthalten und Überläufern das Überleben versprechen. Kurz darauf taucht der junge Leiter des sowjetischen Sonderkommandos Rykov auf, gesandt, um Verräter in den eigenen Reihen zu enttarnen. So entspinnt sich in der realen, existenziell bedrohlichen Kriegssituation ein weiteres Schlachtfeld innerhalb der eigenen Kompanie. Ein Krieg im Krieg sozusagen. Die deutschen Flugblätter und die durch sie angestoßenen Dynamiken innerhalb der sowjetischen Armee werden nun zur größeren Bedrohung; trotz ständigem Beschuss durch deutsche Maschinengewehre fordert Sonderkommandant Rykov das Aufsammeln der – einsam auf dem Feld vor sich hin flatternden – Flugblätter. Verbissen erhebt er sie zum Symbol ideologischer Treue und macht auch vor der schon stark dezimierten Kompanie keinen Halt: Verrat bedeutet für ihn und die Parteiführung ungeachtet der misslichen Kriegsstrategie den Tod. Der stalinistische Unterbau kommt auf absurde Weise zum Vorschein; zu der unkontrollierten Großoffensive gesellt sich ein Krieg in den Köpfen.
Dieser doppelte Krieg erweitert sich hier noch um einen memory war: 77 Jahre nach der Schlacht inszeniert Kopjlov die Schlacht von Ržev als Actionkriegsfilm für das Kino und rückt die Schlacht so wieder in die kollektive Erinnerung. Im Juni 2020, nach Erscheinen des Films, wurde in Ržev ein Kriegsdenkmal in Erinnerung an die gefallenen Soldaten und an die besonders grausame Schlacht eingeweiht. Aleida Assmann schreibt in ihrem Text Europe’s Divided Memory (2013) von den „two conflicting memories”, an Nationalsozialismus und Stalinismus, die unterschiedlich in die kollektive Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Europa eingegangen sind – und so eine Asymmetrie in der europäischen Kriegserinnerung bilden. In Russland herrsche aktuell eine Politik des Vergessens gegenüber dem Stalinterror, im Gegensatz zu der Aufarbeitung kurz nach Kriegsende, zugunsten einer neuen und positiven nationalen Identität: „Although many Russians fell prey to Stalin’s terror, it is much more popular today to emphasize the greatness of Stalin’s victory […] what is still missing is an active, resonant discourse in society about this chapter of the Soviet past.” Hierbei ist anzumerken, dass der Konflikt der Asymmetrie für die transnationale Erinnerung eine erhebliche Rolle spielt. Der unterschiedliche Umgang berührt auch den nationalen Umgang mit Erinnerung. Assman schreibt: „From the Eastern point of view, it is alarming to observe how difficult it is to anchor the crimes of Stalinism in a European memory that is saturated with museums, monuments, and commemoration events relating to the Holocaust.”
Ist denn ein Kriegsfilm wie Ržev in der Lage, solch einen Erinnerungsdiskurs einzuleiten? Was kann er zum russisch-sowjetischen Erinnerungsdiskurs beitragen?
Zum einen lenkt der Film den Blick ursprünglich auf das Versagen der Roten Armee: Denn wie der Film deutlich zeigt, ist die Großoffensive – trotz letztlichem Zurückdrängen der Wehrmacht – allein strategisch zum Scheitern verurteilt gewesen. Genau diese enormen Verluste der Rotarmisten und die fehlgeschlagene Planung der Operationen werden von Kopjlov realistisch dargestellt. Er inszeniert den enormen Verlust der Soldaten der Roten Armee, ihre Ressourcenlosigkeit, die Fehlentscheidungen während der Operationen ohne Beschönigungen oder Milde. Letztlich ist es die Aussichtslosigkeit der Strategie der Sowjetmacht, die den Ausgangspunkt der Filmhandlung ausmacht. Und in dieser Darstellung wagt Kopjlov, durchaus provokativ, einen neuen Blick auf den „Großen Vaterländischen Krieg“ – nämlich einen, der vom Siegesgedenken abtritt. So gesehen hat Ržev einen außergewöhnlichen Beitrag zur kollektiven (Kriegs-)Erinnerung geleistet. Doch geht Regisseur Kopjlov noch darüber hinaus?
Bis zum Ende des Filmes, dem Sieg der Rotarmisten, löst sich das Narrativ des sowjetischen Kriegshelden nicht auf. Die Figurenzeichnung und Dialoge des Films spiegeln trotz der misslichen, realen Ausgangslage – dem Anlass des Films – kaum eine Abkehr vom Siegesgedenken. Vielmehr scheint der Anspruch des Soldaten als (sterbenden) Helden – die „Schande mit Blut zu sühnen“ – für die Heimat einen patriotischen Diskurs offenzulegen. Kleinere Formen der Umkehrung in einen kritischeren nationalen Diskurs verschwinden in regelmäßigen Abständen: Als etwa Sonderbeauftragter Rykov im Schützengraben ausgerechnet von seinem „Arrestanten“ (der „Verräter“, der Flugblätter bei sich trug) aufgrund einer Verletzung umsorgt wird, entspinnt sich zwar kurzzeitig eine Diskussion um den Staat und um Rykovs unablässige Treue zur Generallinie – „Sie haben dir den Kopf verdreht!“ – doch der kurze Konflikt bleibt als solche stehen, wird prompt von einem Angriff der deutschen Wehrmacht unterbrochen – und verschwindet.
Der Film verharrt zudem in Klischees und in dominanten Männlichkeitsbildern. Die Figurenzeichnung des Kriegsfilms ist besonders aufgeladen von Klischees, die den Militär- und Männlichkeitsdiskurs umgeben. Nach der verstörenden und katastrophal geplanten ersten Offensive schämt sich der Politoffizier der Kompanie – um ihn herum etliche gefallene Soldaten – für sein Händezittern: „Ein Politoffizier darf nicht zittern.“ Das stereotype Narrativ des starken Soldaten beherrscht Ržev und seine Figuren durch und durch. Zittert ein angsterfüllter Soldat, so heißt es „Was jammerst du hier herum?“ – Die Soldaten konkurrieren also miteinander: Wessen Hände zittern und wer das Leid nicht erträgt, ist schwach und ein bleiches Gesicht auf dem Schlachtfeld ist Grund zur Scham. Stark ist hingegen der, der ohne Furcht oder Zweifel für die Sowjetunion in die Schlacht zieht. Etwa erzählt der 17-jährige – und damit viel zu junge – Soldat Viktor Simon, dass er sich freiwillig gemeldet habe, „um die Chance nicht zu verpassen.“ Die Soldaten sind stolz auf den „Großen Vaterländischen Krieg“, auf das Schlachtfeld, auf ihre ruhigen Hände. Es herrschen neben der Heldenverklärung duale, simplifizierende Zuschreibungen von schwach/stark oder Feind/Freund, die eine Tiefe und wirkliche Anteilnahme an der Tragik der Kriegssituation und eine differenziertere Auseinandersetzung verhindern. Weitgehender als in diesen Dualitäten wird in Ržev selten gedacht und inszeniert. Es wird sich munter am Genre des Action‑, des Kriegsfilms bedient, ohne mit diesem zu brechen. Natürlich lassen sich Kriegsblockbuster leicht über simplifizierende Narrative erzählen, oder erzählen sich gar nur so, doch wirkt das hier aufgrund der Komplexität der Schlacht und ihrer Tragweite unangebracht. Nur die Tragik der realen historischen Begebenheit, von militärstrategischer Fehlplanung und Vergeblichkeit der Strategie, markiert also einen Bruch mit dieser Blockbuster-Inszenierung – die Kopjlov ja durchaus bewusst gewählt hat. Und doch wird das den Zuschauenden nur beim Anblick der reinen Kriegssituation vor Augen geführt wird, nicht jedoch aufgrund des Zusammenspiels der Dramaturgie, der Dialoge und Figuren. Zusätzlich zu dieser Ambivalenz spiegelt dieses Denken in dualen Zuschreibungen unfreiwillig den russischen Blick auf Kriegsgeschichte: einen unterkomplexen, nicht differenzierten Blick. Kurz: Ein Blick in den Kategorien Gut und Böse.
Zu der Darstellung von Militär und Männlichkeit sind es aber vor allem auch die oberflächlichen, platten Dialoge und emotional unglaubhaften Reaktionen auf das Kriegsgeschehen der Protagonisten, die irritieren und einen kritischen Diskurs verhindern. Sie bewirken, dass eine empathische Teilhabe der Zuschauenden kaum möglich ist. Innere Konflikte und eine realistische Reaktion auf das Gemetzel und die Ausweglosigkeit der Kriegsplanung sind selten: Ein traumatisierter Soldat scheint eher die Ausnahme zu sein. Lediglich eine einzige Figur – der „ehemalige Philosoph“ – nimmt ab und an die Position des Kritikers ein, tritt heraus aus der allgemeinen Abgeklärtheit. Er ist es auch, der die Kriegsführung und ‑strategie anzweifelt, der sich von der Parteilinie distanziert. Ab und an tauchen also kritische Stimmen auf, bleiben jedoch immer nur am Rande der Inszenierung. Entsprechend dem Genre des Actionkriegsfilms, entspinnt sich keine handlungstragende Konfliktsituation unter den Figuren, die über einen Schlagabtausch hinausgeht und die Worte der Figuren werden der Realität der brutalen Schlacht kaum gerecht. Obwohl einige Figuren etwas vom Stereotyp abweichen, fällt auch mit ihnen eine Identifikation schwer. So wieder der – eigentlich klarsehende – „Arrestant“ Rykovs, der dann, in kitschigen Erzählungen schwelgend, seiner Lebensbejahung im Schützengraben Ausdruck verleiht. Es fällt schwer, sich auf solche klischeehaften Zeichnungen einzulassen. Die Extremsituation des Krieges, gepaart mit diesen unnatürlichen, nicht nachvollziehbaren Reaktionen auf das Ausmaßes des Leids, irritieren. Paradebeispiel dafür ist die Figur des Kostik Karzev (gespielt von Ivan Batarev), eine besonders im Kontrast zu der Tragik der Schlacht stehende Gestalt, die einen Großteil der Szenen einnimmt. Karzev ist ein ehemaliger Gauner, der es durch die Bedingungen des Krieges unter falscher Identität aus seinem ursprünglichen Milieu in Moskau herausgeschafft hat und nun sogar leitende Funktion als Soldat hat. Er ist Trinker, ein lockerer Typ, euphorisch-aufgekratzt. Karzev hüpft mit einer Leichtigkeit über die Kriegsgräben und ‑gräber der eigenen Soldaten und schlägt mit munteren Sprüchen oder platten Sprichwörtern um sich. So entgegnet er etwa seinem Kameraden Wanjatka: „Wer zuletzt lacht, lacht am besten.“ Er ist der vitale, nicht zu verstörende Film-Soldat, der kaum berührt scheint von dem Elend um ihn herum. Genau das soll ihn wohl auch zur Identifikationsfigur machen: Die Abgeklärtheit des Soldaten Kostik scheint aber völlig entmenschlicht in Bezug auf die realen Leiden des Krieges und bewirkt so eher Distanz als Identifikation. Die Verzerrung der Tragik des Schlachtfeldes durch die Figuren nimmt dem Film eine entscheidende Ebene: Die der Resonanz im Zuschauerraum. Der Held soll gefeiert werden, für kritische Anteilnahme ist kein Platz. Noch dazu werden die deutschen Feinde als gesichtslos — bis auf einzelne Ausnahmen – inszeniert. Eine Simplifizierung der Zuschreibungen kommt also auch in der dualen Zeichnung der Figuren zur Geltung. Hier offenbart sich wieder der patriotische Blick Kopjlovs auf die Schlacht.
Das einzige, das wirklich ergreift, ist die Brutalität in der Darstellung des Schlachtfeldes, der enormen Verluste und der Brutalität der Kriegslogik Stalins. Kopjlov offenbart durch seine schonungslose Darstellung des Schlachtfeldes und des nicht auszuhaltenden Wartens die Realität des Krieges und entzaubert so auf der einen Seite das Narrativ des „Großen Vaterländischen Krieges“. Die Soldaten der Roten Armee in der Siedlung Osjvannikovo sind der Fehlplanung schlichtweg ausgeliefert. Mehr als diese Entzauberung führt aber eben nicht zur Diskursanregung. Was Kopjlov aber schafft, ist eine Reaktualisierung der Offensive (mit all ihren Fehlplanungen) ins kollektive, sowjetisch-russische Kriegsgedächtnis.
Fast 100 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg erscheint mit Ržev also ein Kriegsblockbuster, der letztlich wieder den russischen, nationalen Diskurs befeuert, anstatt einen umfassenderen Zugang zur Reflexion zu ermöglichen. In Ržev bleibt das Siegesgedenken trotz kritischer Stimmen am Rande schlussendlich bestehen. Der Sieg der Roten Armee und ihr gleichzeitiges, zahlreiches und brutales Sterben stehen sich dabei aber bis zum Schluss gegenüber. So bleibt die Frage übrig, ob Kopjlov bewusst überzeichnet und überwiegend im genretypischen Klischee verharrt; ob die Verhinderung empathischer Teilhabe letztlich Kalkül oder Schwachstelle des Films ist. Fakt ist: Sie beide schaffen eine Distanz zum Grauen der Schlacht. Ob Kopjlov nun bewusst mit der Form spielt oder nicht – um einen männlich-heroischen Siegeszug im direkten Kontrast zu der realen Begebenheit des Scheiterns zu inszenieren – den sterbenden, sowjetisch-russischen Helden wohnt ihre Ambivalenz grundsätzlich inne.
Kopjlov, Igor: Ržev (1942: Ostfront). Russland, 2019, 133 Min.
Literatur
Assmann, Aleida (2013): Europe’s Divided Memory. In: Fedor, Julie (Hg.): Memory and Theory in Eastern Europe.


